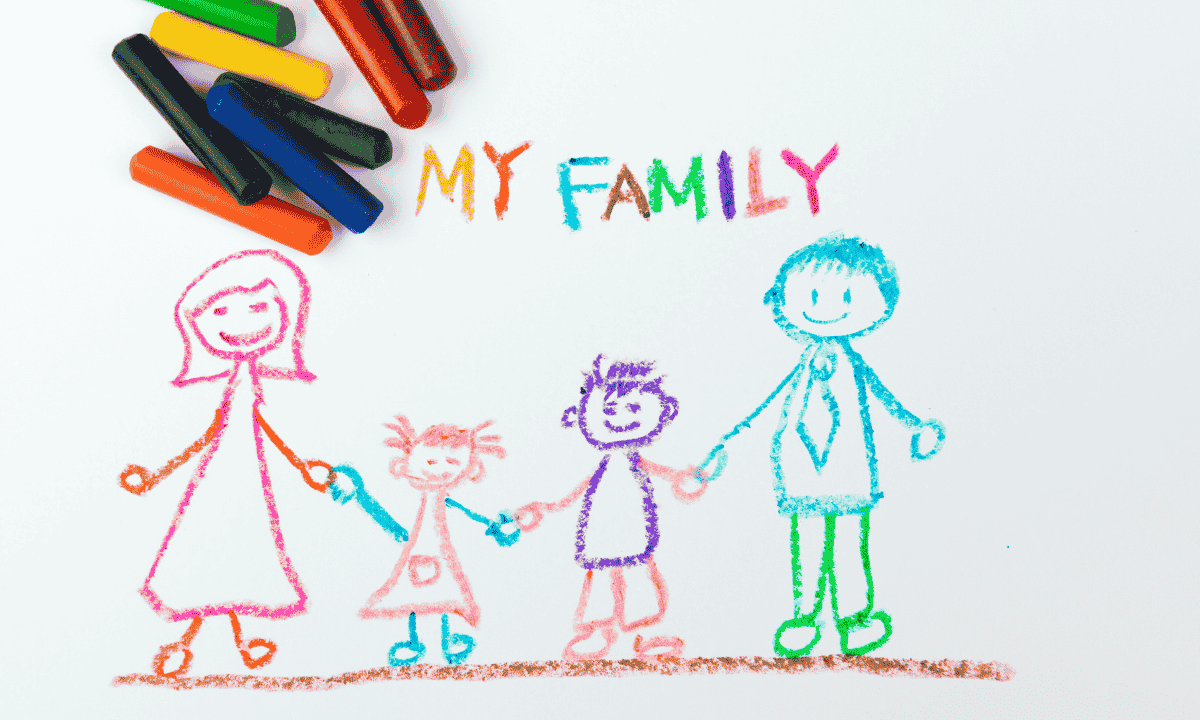Aktuell sind wir in unserer Arbeit vermehrt mit Eltern konfrontiert, die multiplen Problemlagen ausgesetzt sind und oft in der Erziehung ihrer Kinder an Grenzen stoßen. Im Interview erzählt uns Nicole Karrer, wie sie in ihrer Praxis mit Eltern arbeitet, welche Haltung wichtig ist und wie sie es schafft, Veränderung anzustoßen.
Nicole Karrer: Ich erlebe es als total hilfreichen Ansatz, wenn ich zum Anfang der Beratung den Fokus auf die elterliche Haltung setze. Haltung ist ein bisschen sowas wie ein Gleis. Also, wenn Eltern auf dem Gleis „Kinder verhalten sich so, weil es für ihre Entwicklung gerade sinnvoll ist und nicht, um die Eltern zu boykottieren“ sind, dann verändert sich der Blick der Eltern auf die Kinder. Meiner Erfahrung nach komme ich damit bei Eltern, die einen Veränderungswunsch haben, relativ schnell ins Arbeiten. Hier finden wir auch eine Parallele zur „Neuen Autorität“. Auch Haim Omer vertritt in seinen Büchern die Haltung, dass Beziehung nur dann gut gestaltet werden kann, wenn Eltern sich als Anker und nicht als Kontrolleur*innen verstehen und die elterliche Präsenz als hohe Wirkkraft eingesetzt wird.
Elisabeth Staber: Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste in der Zusammenarbeit mit Eltern, die sich ihren Kindern gegenüber als hilflos erleben?
Nicole Karrer: Das Wichtigste ist es in dem Fall, den Schwerpunkt auf die Elternarbeit zu setzen und dies auch so zu kommunizieren. Das führt erstmal zu einer Systemverstörung, denn viele Eltern kommen mit dem Anliegen zu mir, dass ich ihr Kind „reparieren“ soll. Da braucht es erstmal den Raum, um die Eltern wieder in eine wohlwollende Haltung ihren Kindern gegenüber zu bringen, erst dann hole ich die Kinder und Jugendlichen zu dem Thema dazu. Meine Haltung ist aber, dass die Veränderung im Familiensystem nur von demjenigen ausgehen kann, der das „fertige“ Gehirn hat. Die Eltern sind somit in der Verantwortung für die Gestaltung und auch Grenzsetzung in der Beziehung, nicht die Kinder und Jugendlichen.
Elisabeth Staber: Wie gehst du mit Widerstand bei dieser Schwerpunktsetzung um? Zum Beispiel, wenn Eltern sagen, der Jugendliche müsse doch jetzt auch mal was tun und sich ändern?
Nicole Karrer: Das ist erst mal total normal. Es spiegelt die große Sehnsucht der Eltern nach einem einfachen Weg wider, nachdem sie aus ihrer Sicht schon so viel ausprobiert haben und sich jetzt einfach hilflos und ohnmächtig fühlen. Da braucht es erstmal einen wertschätzenden Teil: „Ja, Ihr Jugendlicher ist herausfordernd, ich sehe, dass er Grenzen testet, ausprobiert und da viele dysfunktionale Strategien hat“, damit sich die Eltern in ihrem Leid ernst genommen und gesehen fühlen. Erst dann kann ich erklären, dass dieses Verhalten häufig mit der Entwicklung des Kindes zusammenhängt. Es ist sozusagen der Job eines Heranwachsenden, das Leben „auszutesten“ und eigene Strategien zu entwickeln. Mein Angebot an die Eltern besteht darin, gemeinsam zu erkunden, wie sie mit diesem oft herausfordernden und grenztestenden Verhalten einen guten Umgang finden. Manche brauchen dafür viel Mitschwingen und kommen dann von selbst in den Veränderungswunsch. Wenn nicht, markiere ich das, indem ich die Eltern spiegele: Sie erwarten von Ihrem Kind in der Entwicklungsphase, dass es sich verändert, und sind selbst in der Haltung, dass bei Ihnen selbst Veränderung schwer ist – wie passt das zusammen?
Elisabeth Staber: In solchen Situationen passiert es auch manchmal, dass Eltern ihre Kinder abwerten, z. B. „Der macht das doch absichtlich“ oder „Die ist einfach böse“. Wie gehst du damit um?
Nicole Karrer: Ich würdige erst mal die Not der Eltern. Denn es zeigt sich ja dadurch eine Komplexitätsreduktion. Indem ich sage: „Der andere ist böse“, schiebe ich das Problem zum Anderen und bin in der Haltung: „Ich kann nichts machen“. Als Beratende zeige ich dann aber auch auf, dass es kaum eine Wahl gibt. Es ist ihr Kind, und es bleibt ihr Kind. Also die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist ein erneuter Beziehungsaufbau – sozusagen von vorne anzufangen. Das ist das Eine. Das Andere ist, dass ich versuche, den Eltern die dahinterliegenden Bedürfnisse für das gezeigte Verhalten des Kindes sichtbar zu machen. Also ich versuche zu erklären, um was es dem Kind bei Grenzüberschreitungen tatsächlich gehen könnte, z. B. anhand der vier Grundbedürfnisse nach Grawe.
Ich frage dann auch gerne nach, wie es ihnen selbst als Kinder gegangen ist und ob sie Ähnlichkeiten zu ihrer Kindheit/Jugend erkennen. Wenn da ein „Ja“ kommt, frage ich, was sie damals von den Eltern gebraucht hätten. Da leiste ich viel Übersetzungsarbeit. Diesen Perspektivenwechsel einzuleiten, finde ich methodisch eine der wichtigsten Sachen, die wir in der Elternarbeit machen können. Beziehung kann sich für mich nur verändern, wenn die Eltern es schaffen sich anders zu verhalten und versuchen mit dem Leben ihrer Kinder wieder mitfühlend umzugehen.
Elisabeth Staber: Welche Methoden sind für dich noch wichtig in der Elternarbeit?
Nicole Karrer: Alle Methoden, die mir einen Perspektivwechsel ermöglichen, z. B. die Arbeit mit Grundgefühlen, aber auch die Embodiment-Strategien, um mehr Verständnis von Stresserleben und Regulationsmöglichkeiten zu entwickeln, sind wichtig. H. Omer betont, wie wichtig die elterliche Präsenz ist. Diese kann ich aber nicht gut halten, wenn ich selbst keine Möglichkeiten zur Regulation im Stress habe. Meine Kinder lernen ja auch von mir, wie ich in Stresssituationen günstig handeln kann. Daher suche ich den Zugang zum Empfinden der Eltern zunächst über den Körper. Wo spüre ich Stress, was passiert, wenn ich wütend werde, ab wann habe ich mich nicht mehr im Griff? Was könnte ich bereits davor für mich tun, damit ich nicht die Kontrolle verliere? Daraus erschließt sich ganz natürlich die innere Haltung und die Standhaftigkeit beim Präsenzzeigen.
Elisabeth Staber, Startklar Rosenheim-Ebersberg im Gespräch mit Nicole Karrer, systemische Familientherapeutin